Die Galle – Ein unterschätztes Organ mit entscheidender Funktion
Die Galle spielt eine zentrale Rolle in unserem Verdauungssystem und beeinflusst unsere allgemeine Gesundheit stärker, als viele denken. Doch was genau ist die Galle, wo wird sie produziert, welche Aufgaben hat sie, woraus besteht sie und wie kann man sie mit naturheilkundlichen Maßnahmen unterstützen? In diesem Artikel gehen wir diesen Fragen auf den Grund und zeigen, warum es sich lohnt, der Galle mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Was ist die Galle und wo wird sie produziert?
Die Galle ist eine von der Leber produzierte Flüssigkeit, die für die Verdauung von Fetten unverzichtbar ist. Sie wird in den Leberzellen (Hepatozyten) gebildet und gelangt über ein verzweigtes Gangsystem in die Gallenblase. Dort wird sie gespeichert und bei Bedarf in den Dünndarm abgegeben.
Die Gallenblase ist ein birnenförmiges Organ, das sich an der Unterseite der Leber befindet. Sie kann etwa 30 bis 50 Milliliter Gallenflüssigkeit speichern. Wenn fettreiche Nahrung aufgenommen wird, zieht sich die Gallenblase zusammen und gibt die konzentrierte Galle über den Gallengang in den Zwölffingerdarm (Duodenum) ab. Dort entfaltet die Galle ihre Wirkung, indem sie Fette emulgiert und deren Verdauung erleichtert.
Welche Aufgaben hat die Galle?
Die Galle hat mehrere lebenswichtige Funktionen:
1. Fettverdauung
Die wichtigste Aufgabe der Galle ist die Unterstützung der Fettverdauung. Ohne Galle könnten wir keine Fette aus unserer Nahrung aufnehmen. Die Gallenflüssigkeit wirkt wie ein biologisches Spülmittel: Sie zerlegt große Fettmoleküle in kleinere Tröpfchen, sodass die fettverdauenden Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse (Lipasen) besser arbeiten können.
2. Aufnahme fettlöslicher Vitamine
Dank der Galle können die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K aus der Nahrung aufgenommen und verwertet werden. Diese Vitamine sind essenziell für zahlreiche Körperfunktionen, darunter Sehkraft, Knochenstabilität, Blutgerinnung und Zellschutz.
3. Entgiftung und Ausscheidung
Die Galle hilft dem Körper, Abfallstoffe und überschüssiges Cholesterin auszuscheiden. Die Leber nutzt die Galle, um Giftstoffe und Stoffwechselendprodukte, die nicht über die Nieren ausgeschieden werden können, in den Darm zu transportieren.
4. Regulierung des Darmmilieus
Die Galle trägt dazu bei, das Darmmilieu im Gleichgewicht zu halten. Sie wirkt leicht antibakteriell und verhindert so eine übermäßige Vermehrung unerwünschter Darmbakterien.
Woraus besteht die Gallenflüssigkeit?
Die Zusammensetzung der Galle ist komplex. Sie besteht aus:
- Wasser (etwa 85%) – dient als Transportmedium für die übrigen Inhaltsstoffe.
- Gallensäuren und Gallensalze (10-12%) – emulgieren Fette und helfen bei der Verdauung.
- Phospholipide (vor allem Lecithin, etwa 4%) – unterstützen die Emulgierung der Fette.
- Cholesterin (etwa 0,3-0,5%) – wird teilweise über die Galle ausgeschieden.
- Bilirubin (etwa 0,2%) – ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, das der Galle ihre typische gelblich-grüne Farbe gibt.
- Elektrolyte und andere Stoffe – darunter Hormone, Medikamente und Giftstoffe, die aus dem Körper entfernt werden.
Eine gesunde Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit ist entscheidend für eine funktionierende Verdauung und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden.
Naturheilkundliche Maßnahmen zur Unterstützung der Galle
Da die Galle eine zentrale Rolle in der Verdauung und Entgiftung spielt, ist es wichtig, sie gesund zu halten. Naturheilkundliche Maßnahmen können dabei helfen, die Gallenfunktion zu optimieren und Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen oder Gallensteine zu vermeiden.
1. Ernährung zur Gallenunterstützung
Die richtige Ernährung ist essenziell für eine gesunde Galle. Hier einige Empfehlungen:
- Ballaststoffreiche Lebensmittel (Vollkornprodukte, Leinsamen, Haferflocken) fördern eine gesunde Verdauung.
- Bitterstoffe aus Chicorée, Löwenzahn, Artischocken oder Grapefruit regen die Gallensäureproduktion an.
- Gesunde Fette wie Olivenöl und Leinöl unterstützen die Galle, während gesättigte Fette (z. B. aus fettem Fleisch und frittierten Lebensmitteln) die Gallenflüssigkeit verdicken können.
- Viel Wasser trinken hilft, die Gallenflüssigkeit dünnflüssig zu halten und Gallensteinen vorzubeugen.
2. Heilpflanzen für die Galle
Es gibt zahlreiche Heilpflanzen, die eine positive Wirkung auf die Gallenfunktion haben:
- Löwenzahn (Taraxacum officinale): Regt die Gallenproduktion an und unterstützt die Leber.
- Artischocke (Cynara scolymus): Fördert die Gallenbildung und senkt den Cholesterinspiegel.
- Mariendistel (Silybum marianum): Schützt die Leber und fördert die Gallensaftproduktion.
- Schöllkraut (Chelidonium majus): Hat eine krampflösende Wirkung auf die Gallenwege.
Diese Heilpflanzen können als Tee, Tropfen oder Kapseln eingenommen werden.
3. Bitterstoffe als natürliche Gallenanreger
Bitterstoffe sind für die Galle besonders wichtig, da sie die Produktion der Gallenflüssigkeit anregen. Neben bitterstoffhaltigen Lebensmitteln gibt es auch spezielle Bitterstoffmischungen, die vor den Mahlzeiten eingenommen werden können.
4. Bewegung und Stressreduktion
Regelmäßige Bewegung unterstützt die Gallenfunktion, indem sie den Stoffwechsel und die Verdauung fördert. Stress kann hingegen zu Gallenproblemen führen, da er die Verdauung verlangsamt und die Gallensekretion hemmt. Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder Atemübungen können helfen.
5. Leberwickel zur Förderung der Gallenaktivität
Ein warmes Leberwickel kann die Gallenproduktion und den Gallenfluss anregen. Dazu wird ein warmes, feuchtes Tuch auf den rechten Oberbauch gelegt und mit einer Wärmflasche bedeckt.
Welche Blutwerte geben Aufschluss über die Gallenfunktion?
Um festzustellen, ob die Galle gesund ist oder ob es Anzeichen für eine Gallenstauung, Entzündung oder andere Störungen gibt, werden bestimmte Blutwerte untersucht. Dazu gehören:
1. Bilirubin (Gesamtbilirubin, direktes und indirektes Bilirubin)
- Gesamtbilirubin: Ein erhöhter Wert kann auf eine gestörte Gallenfunktion, Lebererkrankungen oder eine vermehrte Zerstörung roter Blutkörperchen (Hämolyse) hinweisen.
- Direktes Bilirubin (konjugiertes Bilirubin): Ein Anstieg deutet oft auf eine Gallenstauung (Cholestase) hin, z. B. durch Gallensteine oder eine Verengung der Gallengänge.
- Indirektes Bilirubin (unkonjugiertes Bilirubin): Erhöht bei vermehrtem Abbau von roten Blutkörperchen oder Leberfunktionsstörungen.
2. Alkalische Phosphatase (AP oder ALP)
Ein erhöhter Wert kann auf eine Gallenstauung oder eine Blockade der Gallenwege hinweisen. Auch bei bestimmten Leber- und Knochenerkrankungen ist dieser Wert erhöht.
3. Gamma-Glutamyltransferase (GGT oder γ-GT)
Ein wichtiger Marker für Gallenstauungen oder Lebererkrankungen. Ein erhöhter Wert kann auf eine Schädigung der Leber oder eine Blockade der Gallenwege hindeuten.
4. Aspartat-Aminotransferase (AST oder GOT) und Alanin-Aminotransferase (ALT oder GPT)
Diese Enzyme sind Leberwerte, die ebenfalls Aufschluss über Gallenprobleme geben können. Bei einer Gallenstauung können diese Werte leicht erhöht sein.
5. Cholesterin
Da die Galle Cholesterin enthält, kann ein gestörter Gallenfluss zu erhöhtem Cholesterinspiegel führen. Ein hoher Cholesterinspiegel kann wiederum die Bildung von Gallensteinen begünstigen.
Diese Blutwerte sind wichtige Indikatoren für die Gesundheit der Galle und helfen Ärzten, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln.
Die Galle im Rhythmus der Organuhr
Die Organuhr ist ein Konzept der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), das besagt, dass jedes Organ zu bestimmten Tageszeiten besonders aktiv ist. Die Galle hat ihre Hochphase zwischen 23:00 und 01:00 Uhr nachts.
Was bedeutet das für die Gesundheit der Galle?
- Die Gallenblase verarbeitet in dieser Zeit aktiv Fette und unterstützt die Leber bei der Entgiftung.
- Menschen, die in dieser Zeit oft wach werden oder unruhig schlafen, könnten eine geschwächte Gallenfunktion haben oder unter Gallenstörungen leiden.
- Stress, schwere Mahlzeiten am Abend oder eine überlastete Leber können sich negativ auf die Gallengesundheit auswirken und den Schlaf beeinträchtigen.
- Wer oft um Mitternacht aufwacht, sollte auf eine fettarme, leicht verdauliche Ernährung achten und die Leber-Gallen-Funktion durch Bitterstoffe oder Heilpflanzen unterstützen.
Tipps für eine harmonische Gallenfunktion gemäß der Organuhr
- Leichte Abendmahlzeiten: Fettige oder schwere Speisen am Abend vermeiden, um die Galle nachts nicht zu überfordern.
- Bitterstoffe einnehmen: Ein Tee aus Löwenzahn oder Artischocke nach dem Abendessen kann die Galle unterstützen.
- Frühes Zubettgehen: Wer nach 23:00 Uhr noch aktiv ist, stört die Regeneration der Galle und Leber.
- Stressabbau: Meditation oder Atemübungen vor dem Schlafengehen fördern die Entspannung der Organe.
Ihre emotionale Bedeutung
In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und der Psychosomatik wird der Galle nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Funktion zugeschrieben. Die Galle steht symbolisch für Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Aggression, kann aber auch mit Wut, Zorn und unterdrückten Gefühlen in Verbindung gebracht werden.
Emotionen, die mit ihr verbunden sind
- Wut und Zorn: Wer oft „vor Wut kocht“ oder „Gift und Galle spuckt“, hat möglicherweise energetische Blockaden in der Galle. Diese Menschen unterdrücken ihre Gefühle entweder oder lassen sie explosiv heraus.
- Ärger und Frustration: Wer ständig mit Ärger kämpft oder das Gefühl hat, sich nicht durchsetzen zu können, könnte eine geschwächte Gallenfunktion haben.
- Ungeduld und Reizbarkeit: Ein unausgeglichener Galle-Energiefluss kann zu Nervosität, Gereiztheit oder sogar plötzlichen Wutausbrüchen führen.
- Entscheidungsschwäche: Die Galle wird in der TCM mit der Fähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen, in Verbindung gebracht. Wer ständig zögert und sich nicht entscheiden kann, könnte energetische Blockaden in diesem Bereich haben.
- Verhärtete Haltung und Verbitterung: Wer lange Zeit nicht geäußerten Ärger in sich trägt, riskiert, innerlich „verbittert“ zu werden – ein Zustand, der sich auch in Gallenproblemen wie Gallensteinen widerspiegeln kann.
Hier sind drei sprachgebräuchliche Ausdrücke zur Galle:
-
„Gift und Galle spucken“ – Bedeutet, sich stark über etwas aufzuregen und wütend oder gehässig zu schimpfen.
-
„Ihm läuft die Galle über“ – Beschreibt einen Zustand der inneren Wut oder Frustration, die sich nicht mehr zurückhalten lässt.
-
„Eine Laus ist ihm über die Leber gelaufen“ – Wird verwendet, wenn jemand plötzlich schlechte Laune hat oder sich ärgert.
Beispiel: „Was ist denn mit ihm los? Ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen?“
Wie Emotionen die Galle beeinflussen können
Stress, unterdrückte Wut oder anhaltender Ärger können den Fluss der Gallenflüssigkeit stören und zu Gallenstauung oder -steinen führen. In der Psychosomatik wird eine schlechte Gallenfunktion oft mit nicht verarbeiteten Emotionen oder langjährigem Groll in Verbindung gebracht.
Emotionale Balance für eine gesunde Galle
Um die Galle emotional zu unterstützen, helfen folgende Maßnahmen:
- Bewusste Wutbewältigung: Nicht jede Emotion muss sofort ausgelebt werden, aber regelmäßige Reflexion, Tagebuchschreiben oder Meditation können helfen, Gefühle zu verarbeiten.
- Bewegung: Sport kann helfen, angestaute Wut abzubauen. Besonders geeignet sind intensive Bewegungsformen wie Laufen, Boxen oder Tanzen.
- Entspannungsübungen: Yoga, Atemtechniken oder Achtsamkeitsmeditation können helfen, die emotionale Balance wiederherzustellen.
- Kräuter für emotionale Harmonie: Pflanzen wie Baldrian, Melisse oder Lavendel wirken beruhigend und können helfen, emotionale Spannungen zu lösen.
Wer oft an Gallenproblemen leidet, sollte also nicht nur auf die körperlichen Symptome achten, sondern auch auf emotionale Belastungen und ungelöste Konflikte.
Beschwerden und Symptome der Galle – Wie erkenne ich Gallenprobleme?
Beschwerden und Symptome der Galle – Wie erkenne ich Gallenprobleme?
Probleme mit der Gallenblase oder dem Gallenfluss können sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen. Viele Symptome sind zunächst unspezifisch, sodass sie leicht mit Magen-Darm-Problemen verwechselt werden. Hier erfährst du die häufigsten Beschwerden, mögliche Ursachen und worauf du achten solltest.
1. Typische Symptome von Gallenproblemen
-
Schmerzen im rechten Oberbauch
- Häufig unterhalb der rechten Rippe spürbar
- Können dumpf oder stechend sein
- Verstärken sich oft nach fettigem Essen
- Manchmal ausstrahlend in den Rücken oder rechte Schulter
🔹 Hinweis: Anhaltende oder kolikartige Schmerzen könnten auf Gallensteine oder eine Gallenblasenentzündung hindeuten.
-
Völlegefühl und Blähungen
- Unangenehmes Druckgefühl nach dem Essen
- Aufstoßen oder Blähungen, besonders nach fettigem Essen
- Verdauungsträgheit
🔹 Hinweis: Kann auf einen gestörten Gallenfluss hindeuten, bei dem Fette nicht richtig verdaut werden.
-
Übelkeit und Erbrechen
- Meist nach fettigen oder üppigen Mahlzeiten
- Manchmal begleitet von Schwindel
🔹 Hinweis: Tritt häufig auf, wenn die Gallenblase überlastet ist oder Steine den Gallenfluss blockieren.
-
Fettunverträglichkeit
- Schweregefühl im Magen nach fettreichen Speisen
- Durchfall oder fettige, glänzende Stühle
- Blähungen nach dem Verzehr von fettigen Speisen
🔹 Hinweis: Die Galle hilft bei der Fettverdauung – eine Störung kann zu Unverträglichkeiten führen.
-
Gelbfärbung der Haut und Augen (Gelbsucht / Ikterus)
- Gelbliche Verfärbung der Haut und Augen
- Dunkler Urin, heller Stuhl
- Oft begleitet von Juckreiz
🔹 Hinweis: Kann auf eine Verstopfung der Gallenwege hindeuten, z. B. durch Gallensteine oder eine Entzündung.
-
Juckreiz am ganzen Körper
- Besonders nachts oder ohne sichtbare Hautveränderungen
- Begleitet oft Gelbsucht
🔹 Hinweis: Durch eine Gallenstauung können sich Gallenbestandteile im Blut ansammeln und Juckreiz auslösen.
-
Gallensteinkolik (heftige Schmerzattacken)
- Plötzliche, starke Schmerzen im rechten Oberbauch
- Oft mit Übelkeit und Schweißausbrüchen
- Schmerzen können in Rücken oder Schulter ausstrahlen
🔹 Hinweis: Eine Gallensteinkolik tritt auf, wenn ein Stein den Gallengang blockiert – ein medizinischer Notfall!
Welche Erkrankungen stecken dahinter?
🔸 Gallensteine (Cholelithiasis)
- Ursache: Übersättigte Gallenflüssigkeit, schlechte Ernährung, genetische Veranlagung
- Symptome: Schmerzen, Koliken, Fettunverträglichkeit
🔸 Gallenblasenentzündung (Cholezystitis)
- Ursache: Meist durch Gallensteine ausgelöst
- Symptome: Starke Schmerzen, Fieber, Übelkeit
🔸 Gallenstauung (Cholestase)
- Ursache: Blockierte Gallengänge durch Steine oder Leberprobleme
- Symptome: Juckreiz, Gelbsucht, heller Stuhl, dunkler Urin
🔸 Funktionelle Gallenstörung (biliäre Dyskinesie)
- Ursache: Fehlfunktion der Gallenblase ohne Steine
- Symptome: Völlegefühl, Schmerzen nach fettem Essen
🔸 Gallengangsentzündung (Cholangitis)
-
- Ursache: Infektion der Gallengänge, oft durch Gallenstau
- Symptome: Schmerzen, hohes Fieber, Gelbsucht
Fazit – Die Galle verdient mehr Aufmerksamkeit
Die Galle ist entscheidend für die Verdauung, Entgiftung und den Fettstoffwechsel. Neben ihrer körperlichen Funktion hat sie laut traditioneller Medizin auch eine starke Verbindung zu Emotionen wie Wut, Ärger und Durchsetzungsvermögen. Menschen, die oft mit emotionalen Spannungen oder Entscheidungsschwäche kämpfen, könnten unbewusst ihre Gallenfunktion beeinflussen.
Laut der Organuhr ist sie zwischen 23:00 und 01:00 Uhr besonders aktiv, was bedeutet, dass eine nächtliche Unruhe oder Beschwerden in dieser Zeit auf eine Gallenstörung hindeuten könnten.
Durch eine bewusste Ernährung, den Einsatz von Heilpflanzen, emotionale Balance und eine regelmäßige Überprüfung der Blutwerte lässt sich die Gallenfunktion unterstützen – für eine bessere Verdauung, mehr innere Ruhe und langfristige Gesundheit!
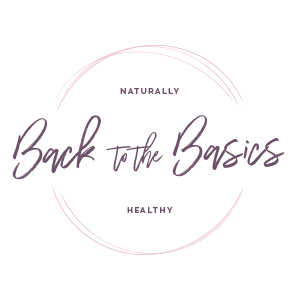

Hinterlasse einen Kommentar